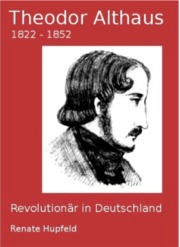Zum Jahreswechsel 1851 / 1852 bekam Theodor Althaus im Krankenhaus in Gotha unerwarteten Besuch von seiner Detmolder Freundin Malwida von Meysenbug, mit der ihn in den Jahren vor der gescheiterten Revolution mehr als Freundschaft verbunden hatte. In ihren Memoiren gibt sie ein eindrucksvolles Bild ihres Erlebens und ihrer Stimmung angesichts des todkranken Freundes im Krankenzimmer:
"An einem kalten Wintertag machte ich mich auf die Reise und kam erst bei anbrechender Nacht in Gotha an. Kaum im Gasthof abgestiegen, liess ich mich zum Hospital führen. Es lag ziemlich weit ausserhalb der Stadt. Ich musste durch stille, einsame Strassen, dann durch eine lange Allee schreiten, zu deren beiden Seiten sich weite mit Schnee bedeckte Felder ausbreiteten, die beim blassen Licht der Sterne wie ein unendliches Leichentuch aussahen. In mir war eine tiefe, feierliche Ruhe; es schien mir, als gehörte ich nicht mehr dieser Erde an und als ginge ich, den geliebten Schatten im Hades aufzusuchen. Ich hatte keine Furcht irgend einer Art, denn ich gehorchte einem inneren Gebot, das nichts mehr zu tun hatte mit irdischen Rücksichten. Endlich sah ich ein einsames Haus, in dem oben zwei Fenster erleuchtet waren. Als ich eintrat, fand ich eine alte Frau, die, als ich nach Theodor fragte, sich mir als seine Pflegerin zu erkennen gab und hocherfreut schien, dass jemand komme, um ihn zu sehen. Ich schreib zwei Worte auf ein Stück Papier, um ihm zu sagen, dass ich da wäre. Er liess mich bitten, gleich herauf zu kommen. Ich fand ihn auf dem Sofa liegend, er schien tief gerührt, mich zu sehen. Ich war bis in das Innerste erschüttert von seinem Anblick und dachte, dass das nicht die einzigen Helden sind, die auf dem Schlachtfeld für die Freiheit sterben. Er starb ja auch, ein Kämpfer, an den Folgen des Kampfes. Sein Zimmer war gross und luftig, aber es war doch das Zimmer eines Hospitals, und er war allein da, fern von allen, die er leibte. Er war noch nicht dreissig Jahr, aber er schien mindestens vierzig; ein langer schwarzer Bart hob seine Blässe und Magerkeit noch mehr hervor, und wenn ein Lächeln auf seine Lippen kam, so war es traurig zum Weinen. Ich sagte ihm, dass ich den Gedanken nicht habe aushalten können, ihn an diesen Festtagen allein zu wissen, und es schien ihm schmerzlich, dass niemand der seinigen gekommen war, ihn zu sehen. Ehe ich ihn verliess, bat er mich, den folgenden Vormittag bis zur Essenszeit und den Nachmittag bis zum Abend zu kommen. Ich ging in den Gasthof zurück, traurig und doch glücklich; denn wenn es etwas gibt in der menschlichen Natur, was sie über das Vergängliche erhebt, so ist es die Charitas, das endlose Mitleid, in dem alles Persönliche untergeht, welches das Leiden, die Schwäche, die Hinfälligkeit umfasst, um zu trösten, zu retten, um den Tod noch zu verschönen. Selbst die grösste Intelligenz hat ihre Grenzen, irrt zuweilen, lässt sich verblenden. Die grosse Liebe allein, die zugleich Mitleid, Erbarmen, Vergessen aller Selbstsucht ist, d i i allein ist unfehlbar, strömt aus einer unbekannten ewigen Quelle und macht das Herz zu einem Tempel, wo sich die Mysterien der einzigen wahren Religion feiern; der Religion, welche rettet und vergibt.
Am folgenden Morgen ging ich um zehn Uhr hin. er hatte sein Zimmer schön aufräumen lassen und seine Krankentoilette etwas sorgfältiger gemacht. Ich hatte mir eine Handarbeit mitgebracht, setzte mich ihm gegenüber an den Tisch und nähte. Wir sprachen von tausenderlei Dingen und er wurde immer heiterer. Viel Lesen und Schreiben war ihm unmöglich, weil es seinen Kopf zu sehr anstrengte; es blieb ihm also nur das Gespräch. Wenn ich sah, dass auch dies ihn ermüdete, schwieg ich; er lehnte den Kopf zurück auf das Kissen und schloss oft die Augen, ich arbeitete fort, bis er selbst das Gespräch wieder anfing. Am Nachmittag war es ebenso; er warf mir sogar vor, spät gekommen zu sein. Unser Gespräch war sehr belebt.
Am folgenden Tag war Sylvester. Er lud mich ein, am Abend zu bleiben und sein Abendessen zu teilen. Ich hatte einige Kleinigkeiten mitgebracht, die er, wie ich wusste, leibte, um ein kleines Fest zu bereiten; die gute Krankenwärterin, die mich schnell liebgewonnen hatte, half mir alles ordnen. Theodor war heiter; ich gab mir Mühe, es zu scheinen und ihn nicht durch das leiseste Wort daran zu erinnern, dass in unserer Vergangenheit ein Abgrund von Schmerzen lag, deren Urheber er war. Er konnte sich mit seiner Mutter glauben. Auch sprachen wir sehr viel von ihr und unsere Herzen fanden sich in ihrem Angedenken. Mit der Neigung, welche die Sterbenden haben, auf die Ereignisse der Vergangenheit zurückzukommen, da sich die Zukunft ihnen verschliesst, erzählte er auch von Begebenheiten seiner Kindheit, von seiner ersten Liebe zu einem kleinen Mädchen, dann kam er auf seine Beziehungen zu seiner schönen Tante zu sprechen und dachte mit gerechtem Lob ihres Geistes und ihrer Talente. Er rezitierte ein Gedicht von ihr, welches wirklich sehr schön war. 'Aber sie hatte nicht das wahre weibliche Herz', setzte er hinzu, 'sie konnte nicht vergeben.'
Er hielt an und zögerte, in seinen Erinnerungen fortzufahren. Ich forderte ihn nicht auf, sondern wartete, was er sagen würde. Plötzlich fragte er mich, ob sein Bruder mir mitgeteilt habe, was er ihm eines Tages gesagt hätte mit der Bitte, es mir zu sagen. Ich verneinte; darauf sagte er, er hätte ihm von dem Gefühl, welches den Beziehungen zu seiner Tante gefolgt sei, wie von dem besten Gefühl seines Lebens und der edelsten Blüte seiner Jugend gesprochen.
Mit diesen Worten endete das Jahr für mich. Als ich einige Stunden, nachdem ich ihn verlassen hatte, Mitternacht schlagen hörte, fühlte ich brennende Tränen mein Kopfkissen netzten. Ich wusste, dass es das letzte Mal war, dass ein neues Jahr für ihn anfing, und dass, noch ehe es zu Ende ging, er nur noch eine Erinnerung sein würde.
Am Neujahrsmorgen ging ich früh aus, um zu sehn, ob ich Blumen kaufen könne. Er liebte sie so sehr und hatte mir einst so viele gegeben, dass ich ihm gern diese Überraschung machen wollte. Aber die kleine Stadt kannte solchen Luxus nicht: Blumen im Winter! Endlich sagte man mir, dass der Gärtner eines fürstlichen Lustschlosses, welches eine gute Strecke weit ausserhalb der Stadt lag, vielleicht welche habe. Ich ging hin, und wie gross war meine Freude, einen Topf mit einer blühenden Hyacinthe und einen andern mit Tulpen zu finden. Der Gärtner wollte sie mir zuerst nicht geben, aber ich bezahlte sie gut und erhielt sie. Nun trug ich sie selbst den weiten Weg zurück. Ein eisiger Wind wehte über die schneebedeckten Felder; ich fürchtete für meine Blumen und hielt schützend meinen Mantel um sie, wie um zwei liebe Kinder, während der Wind mir den Schleier wegriss und die scharfe Luft mein Gesicht zerschnitt. Ich wurde durch Theodors Lächeln belohnt, als ich die Blumen auf seinen Tisch setzte; durch die Freude, mit welcher er die süssen Düfte einzog, die ihm so viel köstliche Empfindungen zurückriefen, ihm, der die Natur ebenso leidenschaftlich liebte, wie ich.
Zwei Tage vor meiner Abreise war er sehr schwach; er konnte kaum sprechen und eine fieberhafte Unruhe trieb ihn, im Zimmer umherzugehen oder sich bald hier, bald dort, erschöpft hinzusetzen. Er hatte nur ein Sofa und gewöhnliche harte Stühle im Zimmer. Ich sann auf Mittel, ihm etwas grössere Bequemlichkeit zu schaffen, indem ich ihm einen Lehnstuhl fände, und lief durch die Stadt, einen zu mieten. Zu vermieten waren aber keine da, wohl aber zu verkaufen. Ich zögerte ein wenig; ich hatte gerade genug Geld, um meine Wirthausrechnung und meine Rückreise zu bezahlen. Aber ich sagte mir, ich würde in der dritten Klasse fahren. Er hatte den Lehnstuhl nötig, ich kaufte ihn. Ich liess ihn in sein Zimmer tragen und ging, den letzten Abend bei ihm zu verbringen. Er war sehr gerührt, und als er mir die Hand zum Abschied reichte, sagte er mit bewegter Stimme: 'Man hat behaupten wollen, dass die demokratischen Frauen kein Herz hätten; es ist an mir, dem zu widersprechen.' Das waren die letzten Worte, die ich von ihn hörte. Ich konnte ihm nichts sagen. Mein Blick war von Tränen verschleiert; ich wusste, es war der ewige Abschied." (Memoiren I, S. 349-355)
Dr. Hassenstein musste angesichts von Theodors Symptomen ziemlich ratlos gewesen sein. Er versuchte immer wieder neue Therapieansätze, von Einreibungen, Eisenbädern, Schwefelsäure Fußbädern, Pulvern und starke Dosen Chinin. Nichts führte zur gewünschten Besserung. Im Gegenteil, die Medikamente verursachten Schmerzen, Dumpfheit und Mattigkeit. Heute wissen wir, dass es ein Krankheitsbild war, das im Jahre 1845 zum ersten Mal von Dr. Rudolf Virchow (1821-1902) beschrieben und von ihm als Leukämie bezeichnet wurde:
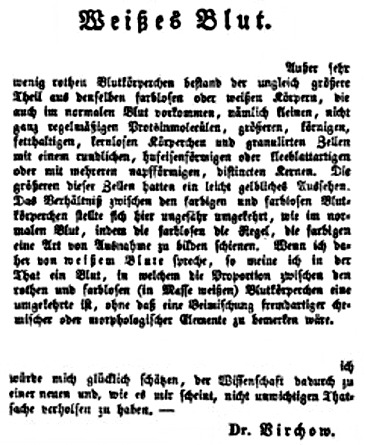
Ende Februar 1852 besuchte Vater Althaus seinen Sohn ein zweites Mal in Gotha. Er wollte den Sohn nach Detmold holen. Theodor glaubte, bald reisefähig zu sein, wenn er keine Medikamente mehr nehmen würde. Doch die Symptome wurden immer gravierender. Er bekam Blutungen, die tagelang anhielten und ihn völlig schwächten, sodass an eine Reise gar nicht zu denken war. Am 31. März 1852 berichtete er seinem Bruder Friedrich von der überraschenden Hilfe eines Freundes aus besseren Tagen, den Schriftsteller Arnold Schlönbach (1817-1866), der ihn mit Blumen und Lektüre versorgt und ihm die Tage ein wenig angenehmer macht. Dazu vermerkt Friedrich Althaus:
"in der klaren fließenden
Handschrift seiner besten Zeit geschrieben, und, wenn auch in ernst resignirter
Stimmung, doch nicht ohne den Hinweis auf Pläne für die nächste Zukunft, ahnte
ich nicht, daß dieser Brief in Wahrheit der Abschiedsbrief sein sollte, der er
war. Nur wenige Tage nach seinem Empfang folgte ihm die Nachricht von Theodor's
Tode. Nach neu eingetretenen heftigen Blutungen war er am Abend des 2. April,
während seine treue Pflegerin sein müdes Haupt im Arme hielt, ohne Kampf und
Schmerz entschlafen.
Ich erreichte Gotha zu spät, um, wie ich gehofft, dem theuern Bruder das letzte
Geleit geben zu können. Vor der Thür des Krankenhauses begegnete ich meinem
Vater, der eben von dem Begräbniß zurückgekehrt war. Außer ihm und dem Arzte
waren mehrere in Gotha ansässige Schriftsteller und Künstler, unter ihnen
Schlönbach, dem mit Blumen geschmückten Sarge gefolgt. Ein Geistlicher hatte den
Segen gesprochen, Chorschüler hatten einen Choralvers gesungen. Auf der Gruft
fanden wir später von unbekannter Hand einen Immortellenkranz und zwei
Cypressenkränze zu Häupten und zu Füßen. Der Stein, welcher die Stelle
bezeichnet, an der Theodor ruht, steht in der Nähe des Denkmals, welsches in den
siebziger Jahren den Sedankämpfern auf dem hochgelegenen Kirchhof errichtet
wurde." (Lebensbild S. 457)
Biografie ist als Taschenbuch erschienen...
Biographie in der Kindle Edition erschienen:
Leseprobe hier:
Texte von Theodor Althaus beim Aisthesis Verlag Bielefeld: